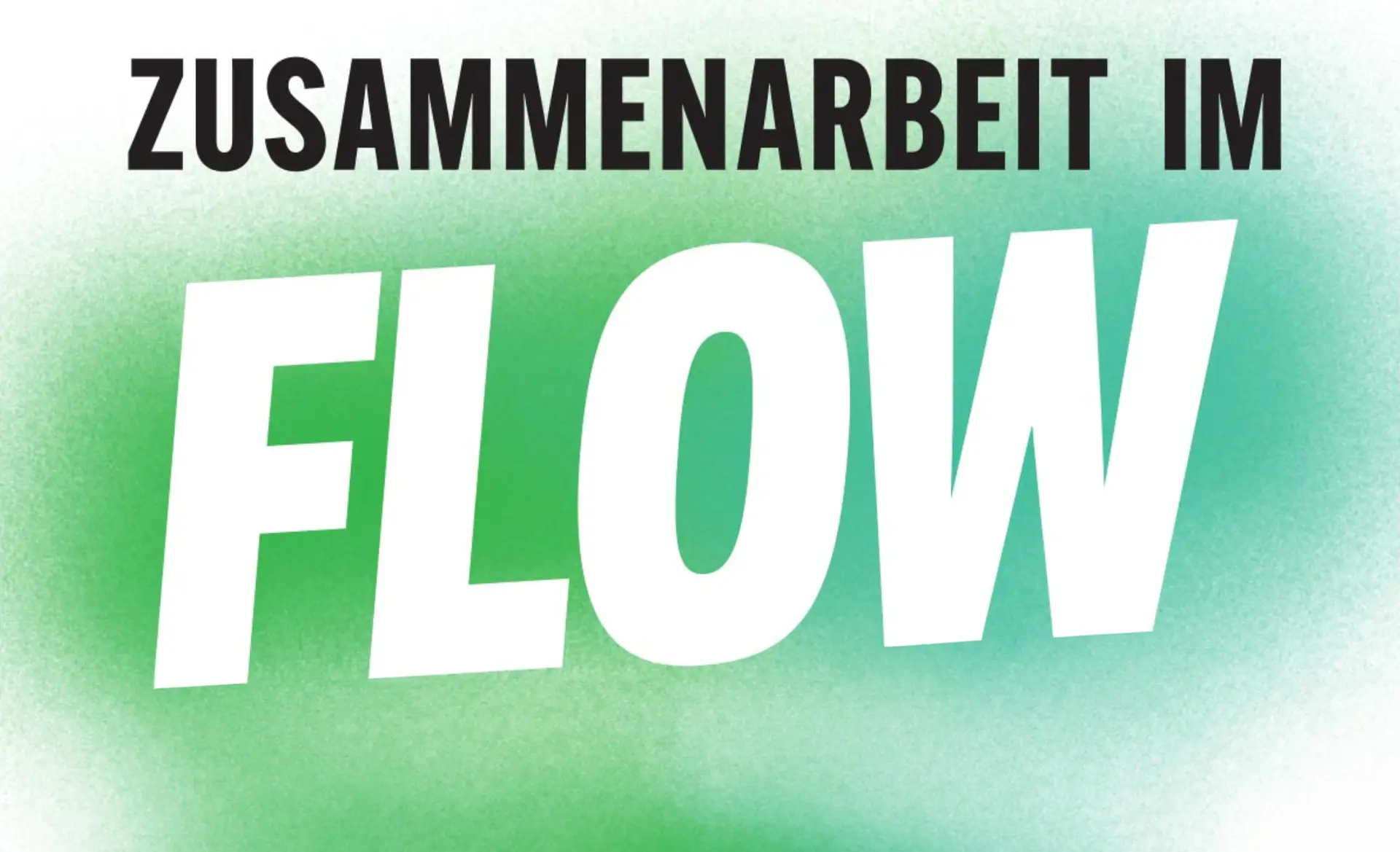Zu oft «spielen» wir Arbeit, als ob sie eine Performance wäre. Zu selten fragen wir uns, warum wir eigentlich tun, was wir tun. Die Folge: Arbeit stockt, ist ineffizient und macht keinen Spass. Nadja Schnetzler und Laurent Burst laden ein zu einem radikal anderen Blick auf Kollaboration.
Text: Robin Adrien Schwarz – HR Today September 2025
«Unser Lieblings-KPI ist: Macht es Spass?», sagt Laurent Burst. Hinter ihm: ein Bücherregal mit Aufbewahrungsboxen, Tüten mit Stiften, Post-its überall. Eines davon mit einem ge- zeichneten Herz, das strahlt. Nadja Schnetzler, hinter ihr ein abstraktes Kunstwerk, findet: «Die Frage, wie man Arbeit so einrichten kann, dass sie bisschen besser fliesst und mehr Spass macht, ist zentral.»
Nadja Schnetzler und Laurent Burst arbeiten seit Jahrzehnten zusammen. Zunächst bei der Ideenfabrik «BrainStore», später gründeten sie das Schweizer Online-Magazin «Republik» mit. Heute beraten sie gemeinsam Unternehmen. Ihre Leitfrage: Wie kriegen wir es hin, dass alle im gleichen Boot sitzen und alles fliesst? Aus all ihren Erfahrungen in der Zu- sammenarbeit mit Unternehmen haben die beiden kontinuier- lich einen «Werkzeugkasten» entwickelt – und mit «Zu- sammenarbeit im Flow» ein Buch geschrieben.
Warum tun Sie eigentlich, was Sie tun?
Am besten funktioniert das, erklären Schnetzler und Burst, wenn man stets zwei Dinge im Auge behält: Purpose und Flow. Purpose: «Antrieb oder Motor, der tiefere Grund, warum wir etwas tun». Purpose sei nicht der Ist-Zustand, sondern eine Art «gespanntes Gummiband in die Zukunft». Ein «Leuchtstern und Kompass für die Zusammenarbeit», der kontinuierlich gepflegt werden will «wie ein Sauerteig, sonst geht er ein», sagt Schnetzler. «Wenn du den Purpose kennst und weisst, weshalb du da bist, ist die Wahrscheinlichkeit gigantisch, dass du die Dinge tust und die Entscheidungen triffst, die diesen Purpose nähren. Ohne wird es schwierig», sagt Burst.
Zusammenarbeit funktioniert am besten, wenn alles fliesst – eben, Flow. Um zu verstehen, was die beiden mit Flow meinen, braucht es keine Theorielektion: «Die Idee ist: ‹Hey, achte doch einfach darauf, wie sich die Arbeit anfühlt. Fühlt sie sich gut an? Geht es vorwärts? Werden die Dinge fertig? Oder ist es ein riesiger Krampf? Wie kannst du es einrichten, dass es ein bisschen besser fliesst?›»
Statt bei Problemen und Konflikten Feuerwehrübungen zu starten und Schuldige zu suchen, solle man «die Flow-Brille aufsetzen» und sich fragen: «Wie können wir da wieder Flow reinbringen?» Mit dieser Frage als Ausgangspunkt finde man andere, hilf- reichere Antworten als mit althergebrachten Methoden.
Spass muss man Erns tnehmen
Vielleicht denken Sie sich jetzt: «Aber Moment, Arbeit muss nicht Spass machen – Arbeit ist schliesslich Arbeit – und Ge- fühle haben im Betrieb nichts verloren!»
Obacht, denn: «Emotionen enthalten wichtige Informationen darüber, ob unsere Bedürfnisse erfüllt sind und ob es bei der Arbeit vorangeht – und warum nicht», sagt Burst. «Unser Körper ist unendlich intelligent. Wenn sich etwas nicht gut anfühlt, bedeutet das etwas. Womöglich begreifen wir das im Kopf noch nicht, aber wenn wir das Gefühl haben, dass es stockt, nicht vorwärts geht, man keine Lust und keinen Spass hat – dann empfehlen wir, das Ernst zu nehmen.» Ernst nehmen heisst hier auch: kommunizieren.
«Das Problem ist oft, dass wir nicht wissen, was die Bedürf- nisse der anderen im Team sind. Weiss man das nicht, projiziert man die Art, wie man selbst tickt, oft auf die andere Person. Teilen wir uns mit, erfahren wir, wie wir in Zukunft aufeinander Rücksicht nehmen können. Es ist nur eine Information und eine Einladung», sagt Burst. Für viele, die diese offene Be- dürfniskommunikation nicht kennen, sei das «wie ein Wunder, weil sie sich das nicht gewohnt sind».
Vogelim Schwarm statt Zahnrädchen in der Maschine
Und Spass? Am Ende des Tages zu denken: «Wow, das hat Spass gemacht, heute haben wir etwas kreiert, es ist gelaufen, es war motivierend!», sagt Schnetzler, sei ein wichtiger In- dikator für Flow – und Spass bringe gleichzeitig Flow. Sowieso würden Menschen heute ihre Arbeit als sinnhaft erleben wol- len und «nicht einfach ein Zahnrädchen in der Maschine sein».
Zu sagen, das sei halt der Job, so habe man das immer schon gemacht (Sie kennen bestimmt andere, ähnliche Floskeln), sei ein Flow-Bremser. «Firma spielen» nennen die beiden es – das Festhalten an alten Strukturen, die im Grunde gar nicht mehr funktionieren und nur noch simulieren, wie Firmen früher funktioniert haben, ohne tatsächlich noch produktiv und effizient zu sein. Die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen Jahrzehnten fortlaufend gewandelt – gerade im Zeitalter von Internet und KI mit rasender Geschwindigkeit. Alte Kategorien und Systeme kommen an ihre Grenzen und werden obsolet. Seit der Industrialisierung verstehe man die Arbeitswelt als Maschine, als fixes Konstrukt, das Fliessband im Zentrum, erklärt Schnetzler. Eine Maschinerie, die so schwerfällig ist, dass sie «gar nicht reagieren kann, wenn eine Krise kommt». Zu lange habe man sich gar nicht mehr gefragt: Stimmt das so für uns?
«Die meisten Firmen sind dermassen ineffizient organisiert», sagt Laurent Burst. Viele erfolgreiche Unternehmen seien heute nicht erfolgreich, weil sie die Zusammenarbeit richtig gestalten, sondern weil sie Marktmacht besässen, ein heraus- ragendes Produkt oder die kritische Masse hinter sich hätten. Das sagt aber nichts über die Arbeit an sich aus, finden die beiden.
«Das Firma-Spiel, das Performen von Arbeit, das ist einfach arm. Arm an Fantasie, an Kreativität, an Vorstellungsver- mögen», sagt Nadja Schnetzler. Schnetzler und Burst schlagen darum eine andere Metapher für Zusammenarbeit vor: den Vogelschwarm. «Zugvögel haben keine CEOs, aber sie haben ein gemeinsames Ziel: unbeschadet in den Süden kom- men! Wenn sich ein Angreifer nähert, kann der ganze Schwarm in Sekundenschnelle reagieren und sich sofort in eine neue Formation verwandeln. Die Intelligenz in einem solchen Organismus ist verteilt bis in den hintersten Flügel», schreiben Schnetzler und Burst in ihrem Buch.
Auf die Arbeitswelt übersetzt: «Wir organisieren uns gerne in kleineren Gemeinschaften und schauen, wie die anderen um uns herum arbeiten und wie sie zum Purpose beitragen. Wenn sich alle an den Nächsten orientieren, dann gehen wir alle in die gleiche Richtung», erklärt Schnetzler. Diese Arbeitsweise würde sogar weniger Energie kosten. «Ich glaube, das ist ein bisschen das Revolutionäre an unserem Ansatz», sagt Laurent Burst. «Oft haben die Menschen den Gedanken, dass es ein- fach so sein müsse, wie es ist, und komplett vergessen: Um was geht es eigentlich? Was ist unser Purpose?»
Erprobte Werkzeuge, ob Montessori-Schule oder Amt Eine solche Kultur der Kollaboration zu etablieren, wie sie sich Schnetzler und Burst vorstellen, mag – gerade in traditions- reichen und starren Unternehmen – wie eine Herkulesaufgabe erscheinen. Doch das Umdenken, das dafür nötig ist, wollen die beiden direkt bei der Arbeit unmittelbar erfahrbar ma- chen. «Wir versuchen immer, von der Praxis her zu kommen und Dinge einzurichten, die funktionieren», sagt Nadja Schnetzler. Darum setzen sie bei einfachen Konzepten an – zum Beispiel bei Meetings. Statt ewige Diskussionen zu führen, die oft durch Einzelne monopolisiert werden, möchten sie, dass alle gleichermassen gehört werden.
Eines ihrer Tools: Zu einer Frage schreiben alle still zwei Minu- ten lang ihre Antwort auf und lesen sie reihum kurz vor, ohne Kommentare von der Seitenlinie, alle hören zu. So finde man nicht nur mehr und bessere Antworten, sondern sei wesent- lich effizienter – auch wenn das auf viele Menschen zunächst kontraintuitiv wirke.
Ein ähnliches Spiel, wenn es um Entscheidungen geht: Man solle sich, wieder mittels Post-its, zur eigenen Meinung be- kennen – ja, nein oder anders. Danach werden zuerst jene gehört, die anders denken, dann die Minderheit, dann die Mehrheit. Auch so möchten die beiden sicherstellen, dass alle – nicht nur die Lautesten und Meinungsstärksten – gehört werden und Minderheitenmeinungen nicht etwa untergehen, obwohl sie vielleicht sinnvoll wären.
Und wenn wir schon bei den Meetings sind: Statt an Sitzun- gen nur über die Arbeit zu sprechen, solle man an Meetings direkt gemeinsam arbeiten. Beispielsweise, indem man klare Tasks sammelt, verteilt, priorisiert und schliesslich kollaboriert, statt dass man isoliert an womöglich unklaren Aufgaben herumknorzt, die dann wiederum der Klärung und weiterer Meetings bedürfen. Das nennen die beiden «Get-it-done- Session».
Schnetzler und Burst haben ihren «Werkzeugkasten» laufend entwickelt. Mit Erfolg – und extrem breiter Anwendung: von rund 70 Menschen an einer Montessori-Schule in Sarajewo über 500 Angestellte des Amts für Arbeitslosenversicherung (AVA) des Kantons Bern bis zu 1700 Menschen in einer grossen Schweizer Versicherung sowie «zahllosen» kleineren Teams in NGOs, grossen Firmen und Familienbetrieben. Die Resonanz, so sagen es Schnetzler und Burst, sei jeweils sehr gut.
Trotzdem braucht Veränderung – auch in einer beschleunigten Welt – immer ihre Zeit. Gerade jene Veränderung, an der Laurent Burst und Nadja Schnetzler arbeiten. «Die Unter- nehmen und die Arbeitswelt sind wie ein sehr schnell fahren- des Schiff. Vielleicht wäre es besser, sich jetzt ans Steuer zu begeben und durch die aufkommenden Wellen zu navigieren, statt sich irgendwo krampfhaft festzuhalten», sagt Schnetzler. «Gerade die jüngeren Generationen bemerken die Mechanismen, die nicht mehr funktionieren. Ja, viele halten noch daran fest und werden das auch noch eine Weile tun. Es wird noch dauern. ‹But we’re on our way out.› Davon bin ich überzeugt.»
Lade ein PDF vom Artikel herunter